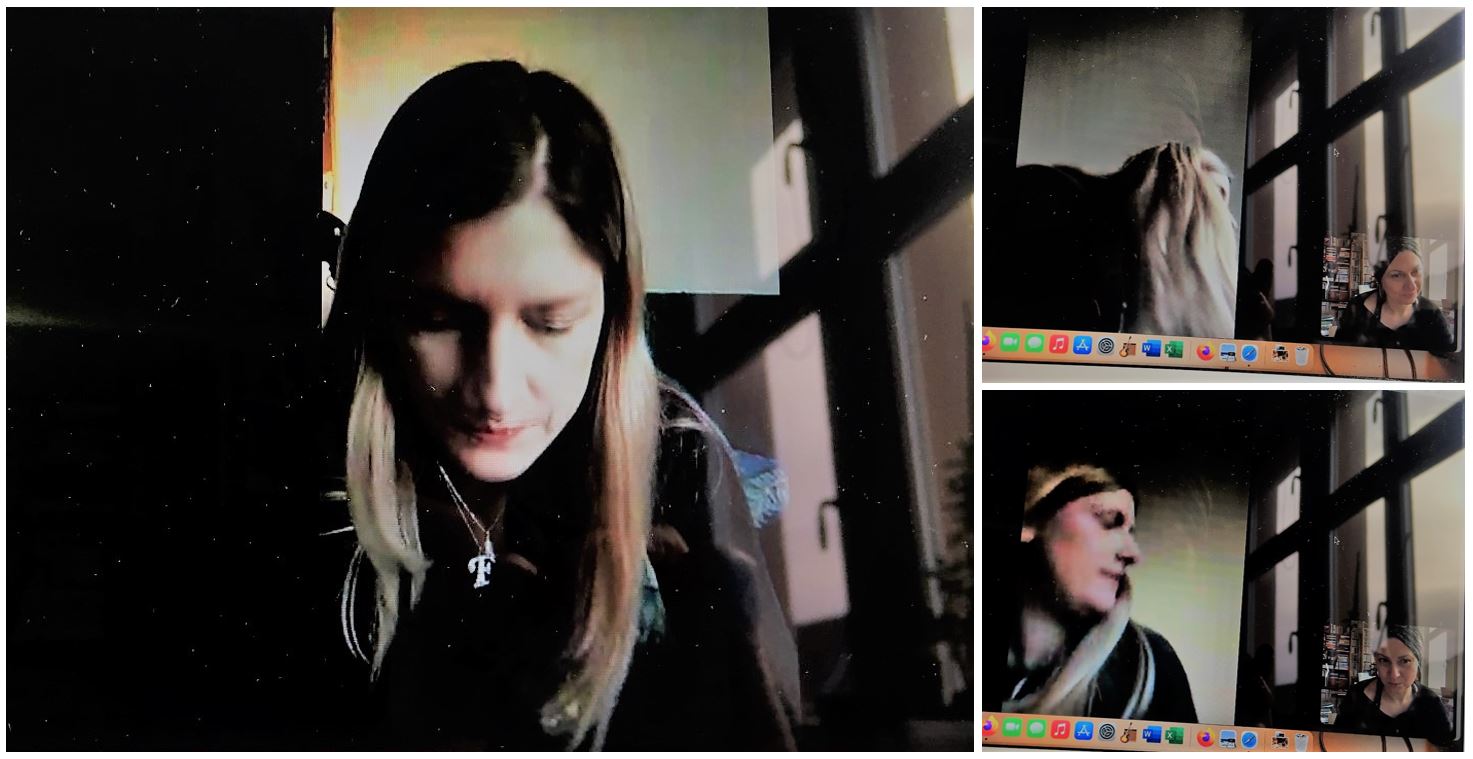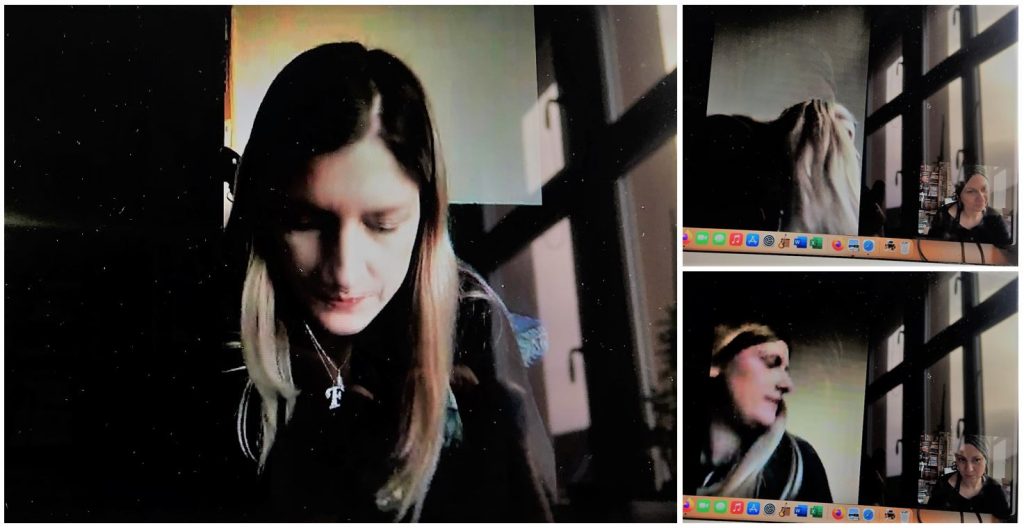Die dunkle Seite der Hingabe oder: Vom Reiz des Problematischen.
Hingabe kann ich. Das ist im Allgemeinen eine gute Sache. Die Kehrseite: Ich kann auch Besessenheit. Im besten Falle ist es jene mit (oder von?) einem Lied: Ganz so, wie ich auch tage-, wochen-, monatelang das Gleiche essen kann, kann ich tage-, wochen-, monatelang das Gleiche hören – ohne, dass mir auch nur im Allergeringsten langweilig würde. Diesen Januar standen drei Songs auf meiner Speisekarte: „Colors“ von den Black Pumas in der Live in Studio-Version, „Highway 74“ von The Hamiltones, wie sie es bei den Roots Music Series spielten – und „Sugar“ von Kristiina Tuomi. Die Besessenheit mit Letzterem äußert sich ganz konkret darin, dass das Lied die wohl meistmitgesungene Zweitstimme meines Lebens hat, und zwar zu solch einem Ausmaß, dass ich meine eigene Stimme im Moment nicht mehr denken kann, ohne jene von Tuomi darunter zu hören.
Alles begann am 9. Januar 2020 mit einem Konzert namens The Dark Night of Soul im Orania, zu dem ich, von jeher zu jeglichem Seelendunkel hingeneigt, natürlich hingehen musste. Die Erinnerung an dem Abend spülte mir ein dafür berüchtigtes soziales Netzwerk ein Jahr später wieder in die Timeline, hatte ich damals doch ein paar Videos gemacht und gepostet. Das Stück, das ich schon vor einem Jahr als „coolsten Song des Sets“ beschrieben hatte, der als einzige Eigenkompositionen zwischen all den berühmten Covern nicht nur nicht verloren ging, sondern sie noch um Längen schlug, sollte mir zum intimen Begleiter der letzten Wochen werden. Nicht zuletzt, weil mich die „she keeps your heart on a shelf in a jar/and your soul on a chain in the yard“-Zeile getriggert hat, bin ich doch jüngst erst einer nämlich kurzgehaltenen Seele begegnet.
Wie es der glückliche Zufall wollte, wird „Sugar“, unten in der damals von mir gefilmten „Rioja-Version“ (Tuomi) zu sehen, heute von Tuomis neuem Quintett Glymmar veröffentlicht. Ich traf die Berliner Sängerin und Songwriterin, die vielen noch vom auf Traumton veröffentlichten Trio Tuomi im Ohr sein dürfte, zum Gespräch – ’ronakonform per Videokonferenz. Darin ging es nicht nur um die in „Sugar“ besungene dunkle Seite der Hingabe, den eher unjazzigen Stil und ein melancholisches Vernebeltsein, sondern erst einmal – wie das wohl unausweichlich ist, wenn das finno auf das ugrische Element trifft – um Lakritz.
Klangverführer: Schön, dass das mit uns beiden unter diesen widrigen Umständen geklappt hat. Wir wollen heute über deine neue Band Glymmar sprechen. Wie ist die zu diesem flimmernden Namen gekommen?
Kristiina Tuomi: Es ist eine alte Schreibweise von „glimmer“ aus dem Frühneuenglischen. Wir haben ja diesen Song namens „Fire“ gemacht und etwas in der Richtung gesucht – was heutzutage gar nicht mehr so einfach ist mit den Domains! Oder überhaupt einen Bandnamen zu finden, der nicht schon von einer koreanischen Punkband gekapert wurde.
Ich finde, in dem Namen schwingt auch etwas Nordisches mit …
Ja, durch die Schreibweise denken das viele. Ich bin Halbfinnin – aber das wäre jetzt eher ein typisch skandinavischer, also schwedischer oder norwegischer, Name. Und das Skandinavische ist ja auch immer ein Thema. Ich meine, man sieht ja auch so ein bisschen, dass ich aus der Ecke komme. Aber die Finnen sind wirklich nochmal ein eigenes Völkchen und haben mit den Skandinaviern ursprünglich gar nichts zu tun. Die haben sich da angesiedelt, aber eigentlich sind sie mit den Ungarn verwandt.
Ja, ich bin Halbungarin …
Ja, richtig! Es gibt aber nur noch ein einziges Wort, das sich Ungarn und Finnen teilen: „voi“ bzw. „vaj“,“Butter“. Sonst gibt es ja keinerlei Überschneidungen im Vokabular mehr. Hab ich zumindest von einer Ungarin gelernt.
Wenn wir schon keine Worte teilen: Ich habe gehört, dass du eine typisch finnische Vorliebe für Lakritz hast, die ich mit dir teile.
(lacht): Ja, das ist ein Riesenthema. Lakritze! Ich kenn das von klein auf. Meinte Mutter isst keine Süßigkeiten, aber Salmiak, diese salzige Lakritze.
Da bin ich total bei ihr. Ich verabscheue Süßes, aber Salmiak ist super!
In Finnland gibt es sogar Kartoffelchips mit Salmiakaroma. Und diverse Eiskremsorten, das ist so wie hier Schokoladeneis … Da gibt’s Glasur, und mit Stückchen und so fort. Überhaupt gibt es alles mit Lakritze: Es gibt Lakritzpudding, es gibt Lakritzsoße für Eis, das ist da wirklich so ein Standard-Flavor. Und ich liebe das echt. Da muss man aber, glaube ich, mit aufgewachsen sein. Sonst findet man das … Die meisten finden das echt nur eklig! (lacht)
Ich fahr da auch total drauf ab, obwohl ich nicht damit aufgewachsen bin. Wie dem auch sei: Sprechen wir wieder über Glymmar. Wie die Band zu ihrem Namen gekommen ist, haben wir schon gehört – jetzt interessiert mich natürlich ein bisschen was zur Bandgeschichte, wie, wann und warum ihr euch gegründet habt, zum Beispiel.
Also, die Band kam eigentlich eher so ein bisschen nach der Musik. Ich hab angefangen … Also, ich hab eine längere … Ich meine, ich bin ja jetzt keine zwanzig mehr. Ich hab ja schon ein bisschen was auf dem Buckel. Damals war ich sehr viel in der Jazz-Szene unterwegs, und da hat sich auch schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ich einen eher unjazzigen Stil verfolge – man sucht sich’s ja nicht aus, es kommt halt so aus einem raus.
Ich bin da ein sehr intuitiver Songwriter. Ich setz mich dann wirklich hin und versuche, in so einen Flow zu kommen, und dann kommt es aus mir raus, ich zeichne alles auf, und im Nachhinein such ich mir dann die schönen Sachen raus, die da gekommen sind. Und irgendwie ist das, was kommt, immer etwas Dunkles, Melancholisch-Verträumtes – das muss jetzt nicht immer Moll-ig sein, aber es ist irgendwie immer ein bisschen vernebelt. Und es hat auch Anleihen an Minimal Music – ich mag halt solche repetitiven Patterns.
Schon damals im Jazz hatte ich ein Trio mit Carlos Bica und Carsten Daerr, Tuomi. Als wir das gegründet haben, hab ich noch studiert. Und das ist auch schon durch besonders dunkle Töne aufgefallen. Das hat immer polarisiert. In den Jazzclubs immer so düstere Stücke zu bringen, das ging für manche gar nicht! (lacht) Es gab halt einerseits richtige Fans, die auch immer noch Fans sind, das ist total süß, von denen höre ich immer wieder, Mensch, wann gibt es mal wieder was von Tuomi? Und dann gab es eben auch Leute, die kamen und sagten, das ist doch kein Jazz mehr!
Carlos Bica war dabei, sagst du?
Ja, er ist ein Kontrabassist, der sehr virtuos mit seinem Instrument umgehen kann, er spielt sehr melodiös und teilweise in Cellolage. Er ist in Portugal recht bekannt, da kommt er her, lebt aber mittlerweile hier. Er hat viel mit Maria João gespielt und hatte dann ein Trio mit Jim Black und Frank Möbus, Azul. Wir haben ihn uns damals rausgepickt, weil er sehr … er hat halt selbst auch so romantische Stücke geschrieben, und wir haben gemerkt, er passt einfach seelisch zu uns. Und das hat mich lange geprägt.
Ich hab das zehn Jahre lang gemacht. Wir haben getourt und alles, Goetheinstitutstouren und Touren durch die Jazzclubs im deutschsprachigen Raum, wir haben zwei Alben bei Traumton gemacht … Und dann habe ich gemerkt, dass ich immer mehr den Drang hatte – und ich scheue den Begriff „Popmusik“ immer so ein bisschen, weil die Leute immer sofort so eine ganz klare Vorstellung haben, was das ist, und das ist es dann meistens doch nicht so ganz! – also den Drang hatte nach etwas, das so ein bisschen zwischen den Stühlen hängt. „Sugar“ zum Beispiel, der Song, um den es heute geht, der hängt auch zwischen den Stühlen: Er ist tatsächlich sehr poppig, so richtig mit durchgehendem Schlagzeug, aber auch so ein bisschen … „zwischen den Stühlen“ trifft es schon ganz gut. Es war schon immer zwischen den Stühlen gewesen – und das ist auch jetzt so.
Tuomi haben wir aufgelöst, das hatte sich irgendwann totgelaufen. Das war eine ganz natürliche Entwicklung: Irgendwann war es einfach genug. Wir hatten auch nicht mehr so richtig Lust gehabt, noch weiter daran zu arbeiten, und ich wollte immer schon mehr mit Percussion machen, ich wollte gern ein Schlagzeug dabei haben, aber nicht alle im Trio waren damit einverstanden. Ich habe dann erstmal mit meinem eigenen Zeug eine Pause gemacht und als Profisängerin gearbeitet, richtig knackig: Ich hab Event-Jobs gemacht, Werbung eingesungen, Filmmusiken eingesungen … Ich hab einfach Geld verdient – und musste dann erstmal gucken, was ich jetzt überhaupt will, weil ich gemerkt habe, dass ich in der Jazz-Szene nicht weitermachen möchte. Ich musste mich also erstmal finden. Ein bisschen spät – aber ist ja egal! (lacht) Als Frau denkt man ja sowieso immer, man ist zu alt. Es ist eigentlich egal, wie alt man ist, man ist eh immer zu alt! (lacht wieder) Das ist dann aber auch schön, weil man sich dann sagen kann, das ist jetzt auch schon egal!
Ich hab dann jedenfalls ein Kind bekommen, das dann alles an Zeit und Plänen nochmal torpediert hat … Aber ich habe immer zwischendurch Songskizzen aufgenommen. Mich über die Jahre immer wieder hingesetzt, an die Rhodes, ans Klavier, und immer wieder Sachen aufgenommen. Und mein Mann, der zufälligerweise Produzent und Toningenieur ist, hat dann irgendwann gesagt: Ach, lass uns die doch jetzt mal hübsch machen! Damit haben wir dann auch angefangen, aber immer nur sporadisch, weil er halt auch viel gearbeitet hat – er ist der Schlagzeuger der Geschwister Pfister und macht auch viele Aufnahmen … Ja, als Working Musician sein eigenes Zeug zu machen, besonders, wenn man dann schon in der Szene einfach viel zu tun hat, ist nicht so einfach! Aber dann kam der Lockdown. Und wir beide waren plötzlich arbeitslos. Da haben wir uns gesagt: Jetzt machen wir das.
Ist Glymmar eine Lockdownband?
Nicht wirklich. Wir haben die Musiker schon vor dem Lockdown ausgesucht. Dafür haben wir auch länger gebraucht. Zum Beispiel mit dem Pianisten: Es war so ein Ding einen Pianisten zu finden, der das so spielen kann, wie ich es höre, in mir drin. Ich spiel ja selbst Klavier beim Schreiben, aber für die Bühne – das würd ich mir nicht anmaßen! Und ich brauchte halt jemanden, der so Minimal-Patterns spielen und die nageln kann – aber auch ’nen Touch hat! Also quasi ’nen Klassiker, ’nen Popmusiker und ’nen Jazzer in einer Person. (lacht) Ich hab da viel rumprobiert. Und war da auch so ein bisschen Diva. Und dann kam mir Benedikt in den Sinn, der mit mir zusammen studiert hat und der in einer ganz anderen Ecke vom Jazz unterwegs war. Ich hab ihn auch privat mal ab und zu gesehen und dachte dann, warum frag ich ihn denn nicht einfach? Der kann das bestimmt!
Und dann hat sich herausgestellt, dass er tatsächlich auch so ein Minimal-Music-Fan ist und das total versteht – einfach *total* versteht, was ich da mache. Das ist wirklich ein Phänomen. Dieses „Secrets“-Stück, das ist ganz ohne Click eingespielt. In der Popmusikproduktion arbeitet man ja eigentlich so, dass man so einen Click reinlegt, und dann spielt jeder einzeln auf den Click seine Sachen ein, und dann legt man das übereinander. Wir haben das aber tatsächlich alles live gemacht. Benedikt hat sich hingesetzt, ich war im selben Raum, Mikrofon vor der Nase, ohne Click, und dann ging’s los! Und er hat das einfach perfekt … Wir haben wirklich gleich den zweiten Take genommen. Unfassbar! Als wäre er ich. Also, meine Verlängerung.
Schön!
Ja, das war großartig. Ich bin ein ganz großer Fan von ihm. Und das ist auch das Herz der Band: das Piano. Wir haben ein echtes Klavier; wir benutzen tatsächlich keine Synthies oder so etwas, es ist ein echtes Klavier, es steht im Studio, es ist ein ganz altes, warmes … Es hat so einen ganz dicken, warmen Sound, auf dem hab ich das geschrieben und damit nehmen wir auch alles auf. Es hat einen ganz charakteristischen Klang. Und es knarzt auch richtig! Am Ende von „Secrets“ hört man, wie das Pedal so Krrrk-krrrrk macht.
Ihr habt bislang drei Singles veröffentlicht: „Moon Behind A Cloud“ im November 2020, „Fire“ im Dezember, „Secrets“ im Januar und jetzt im Fast-Februar „Sugar“. Was steckt hinter dem Konzept, jeden Monat eine Single, aber kein Album zu veröffentlichen?
Damit habe ich mich ziemlich beschäftigt. Also alles, wie es normalerweise läuft, geht ja gerade nicht. Normalerweise, in unserer Szene als Live-Musiker, als Band, die live auftritt und kein Studioprodukt ist, läuft es so, dass man Konzerte spielt und dabei eine kleine Fanbase aktiviert, die dann das Album auf den Konzerten kauft. Das geht halt im Moment nicht.
Das war ja der Hauptvertriebsweg für Alben in Streamingzeiten: der Merch-Stand auf den Konzerten, oder?
Normalerweise ja. Aber bei Tuomi war es so – aber das ist auch wirklich schon länger her, da gab es noch kein Spotify, und noch nicht mal Facebook war da so richtig am Start, das war 2004 und 2007, als wir die Alben gemacht haben –, dass es da noch ganz anders war: Da ging man in den Plattenladen und holte sich eine CD. Und da war das auch für Musiker noch nicht so schwierig, wir haben da auch was verkauft! Die Stefi von Traumton hat ein paar Pressebemusterungen gemacht, dann haben wir Presse gehabt und dann sind die Leute losgegangen und haben die CD gekauft! Oder sie bestellt. Und das lief ganz gut!
Und auch live war es bei uns immer ganz gut besucht, auf Tour haben wir immer auch verkauft, das war schon schön. Und im Radio liefen wir auch mal. Also, jetzt nicht bei Radio Energy (lacht), aber im Kulturradio. Also in der typischen Jazz- und Kulturnische. Und das funktionierte ja auch, denn die Fans dort wissen ja, dass man die Künstler unterstützt, indem man die CD kauft.
Das hat sich seitdem, während dieser Pause, die ich gemacht habe, alles total geändert. Ich saß dann da, mit dieser Musik, und dachte: Wie mach ich’n das jetzt? Und dann hab ich einfach mal geguckt, wie die anderen das so machen. Vor allem in diesem Lockdown. Wir sind ja jetzt rein digital. Man kann nicht spielen – also, man könnte jetzt ein Live-Stream-Konzert machen, das ist bei uns aber tatsächlich nicht so einfach, weil wir so viele sind. Wir sind jetzt fünf Leute, für live würde ich dann natürlich auch Backgroundgesang dazunehmen, dann sind wir bei sieben Leuten … Also, ich bin ja nicht so ein Fan davon, wenn man sagt, och, für die Musik treff ich mich jetzt doch mal auf eine kleine Corona-Party …
Dazu kommt, dass mein Mann, der bei Glymmar Schlagzeug spielt, und ich ein Kind haben – überhaupt haben alle unsere Bandmitglieder Kinder. Und die müssen betreut werden, wenn wir proben. Das ist nicht so einfach, wenn die Kita nicht da ist. Es sind halt diese praktischen Dinge, am Ende. Meine Eltern zum Beispiel sind schon etwas älter. Sie betreuen öfter mal unseren Sohn, aber wenn wir uns jetzt mit mehreren Personen zu Proben treffen würden, dann könnten sie ihn nicht mehr nehmen. Es sind die profanen Dinge, die jetzt entscheiden.
Ihr seid aber alles Berliner, das heißt, wenn Konzerte wieder möglich sind, könntet ihr euch leichter zusammenzufinden, als wenn ihr über ganz Deutschland verteilt wärt?
Ich bin die einzige gebürtige Berlinerin in der Band, aber wir sind alle in Berlin ansässig. Das geht alles. Wir haben auch schon geprobt, bevor es so schlimm wurde, aber dann ging wirklich alles drunter und drüber. Alles sind Profimusiker – bis auf den Pianisten, der hat noch einen normalen Job.
Einen Daytime-Job, der nichts mit Musik zu tun hat?
Ja, das ist seine zweite Leidenschaft, er ist nämlich auch noch Doktor der Mathematik. Hat er einfach noch so rangehängt (lacht). Er arbeitet als Mathematiker. Deswegen macht er jetzt seinen Job – aber für den Rest von uns ist es schwierig. Ich denke immer wieder, man könnte die Zeit zum Proben nutzen, aber das zieht eben solch einen unglaublichen Rattenschwanz an Problemen hinter sich her – und dafür, dass wir dann für einen Facebook-Stream dasitzen, fühlt es sich auch nicht so gut an. Ich bin schon eher so eine Rampensau! (lacht wieder) Und das fehlt mir dann.
Kann man sagen, es gibt die sukzessive veröffentlichten Singles und kein Album, weil es eben keine Record Release Konzerte gibt?
Also, ich glaube, es ist erstmal so, dass diese Songs auch als Singles sehr gut funktionieren. Das macht auch künstlerisch für mich schon Sinn. Weil … Die sind alle in Phasen entstanden und haben auch so ein bisschen ihre jeweils eigene kleine Welt. Es gibt dann auch nicht wie bei einem Album so zwei, drei Songs, die man halt noch macht, weil man ein Album füllen muss, sondern ich versuche wirklich, dass jeder der Songs eine kleine Perle ist. Mir gefällt auch die Idee, für jede Single ein eigenes Cover zu haben. Ich mag Alben, ich höre auch Alben – ich bin ja auch noch alte Schule, aber ich kann diese andere Welt der Singles auch sehr gut verstehen. Mit den neuen Plattformen, wo jetzt Musik gehört wird, macht das schon Sinn.
Ich hab auch noch mehr Songs, die kommen jetzt auch alle nach und nach, aber so bekommt halt jeder Song seine Aufmerksamkeit und seinen Platz. Ich finde das irgendwie schön. Dass alle mal dran sind. Das ist wie so eine Familie mit lauter kleinen Kindern, und jedes hat halt mal Geburtstag. Und nicht alle auf einmal.
Nochmal kurz zu den neuen Plattformen, zu dieser Situation mit dem ganzen Streaming: Ich benutze für Glymmar ja Spotify, und, das muss ich auch sagen, Spotify ist natürlich ein schlimmer kapitalistischer Konzern, der uns alle ausbeutet. Ich mach jetzt mit bei dem Game, mal für ’ne Weile, um das mal auszuprobieren, aber ich werde auf Dauer wahrscheinlich auch zu Bandcamp gehen oder so. Weil: Eigentlich darf man das nicht unterstützen.
Du hast von dieser eigenen kleinen Welt der Songs gesprochen. Lass uns über die Welt vom heutigen Release „Sugar“ sprechen – über die Situation, die der Song reflektiert.
Das ist ein kleines Märchen. „Sugar“ ist ja zweideutig: Es ist nicht nur der Zucker, es ist auch ein Name, so wie „Sugar“ in „Manche mögen’s heiß“. „Sugar“ sehe ich als eine Art Hexe, eine Sirene. Aber ich bin kein konkrete-Lyrics-Mensch. Ich erzähle keine Geschichten, sondern Bilder. Und mir ist es auch recht, wenn es Bilder bleiben. Wenn es zu konkret wird, auch bei Musik, bei Kunst generell, finde ich das problematisch. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, „Sugar“ ist so eine Hexe, eine wunderschöne, verführerische Hexe, die süß ist und einen umgarnt, die einen aber auch heimsucht. Wie Zucker fühlt sie sich toll an, bringt aber auch superviele Schwierigkeiten mit sich. Sie macht süchtig.
Wie eine Droge.
Ja. Und die Zeile „Sugar in my bed“ – ich meine, wenn man Zucker im Bett hat, ist das auch nicht wirklich angenehm, das kratzt halt! Und auch im Blut kann es unheimlich nervig sein. Im Prinzip wie mit allen tollen Dingen, die einen wahnsinnig vereinnahmen: die haben oft auch Nachteile. Drogen, Alkohol, Sex … solche Geschichten haben ja auch immer den Reiz des Problematischen. Ich glaube, dass das etwas zutiefst Menschliches ist, dieses „Ich will, aber ich sollte nicht“. Dieses Gefühl steckt in dem Song: Ich will eigentlich, ah, aber ich weiß, ich darf nicht. Ich sollte nicht. Dieses: Ah, du wirst es bereuen.
Ich wusste doch, es gibt einen Grund, weshalb das Lied mich so triggert!
(beide lachen)
Damit kann wohl fast jeder etwas anfangen. Und die musikalische Umsetzung … Also, mein Mann hat das ja produziert. Ich schreibe nur Riffs auf dem Klavier. Ich mag Rockmusik, ich mag auch harte Rockmusik. Und Riffs auf dem Klavier zu machen, finde ich wahnsinnig spannend. Ich kann leider überhaupt nicht Gitarre spielen, das ist einfach nicht meins, war es auch nie – aber ich versuche, was so ein Rockgitarrist auf seiner Gitarre entwirft, eben: das perkussive und das harmonische Element miteinander zu verbinden, aber auf dem Klavier. Es gibt ein paar Künstler, die das gemacht haben, zum Beispiel Trent Reznor von den Nine Inch Nails. Ich bin immer ein Riesenfan gewesen, schon seit Teenie-Tagen … Halt so ein Rock’n’Roll-Klavier! Tori Amos macht das auch oft, oder Kate Bush. Das sind so meine Einflüsse, und das hört man sicherlich auch im Gesang.
Ich merke bei mir, ich sing jetzt nicht so, wie man heutzutage singt. Da merk ich, dass ich schon ein bisschen länger dabei bin. Meine Einflüsse sind aus einer anderen Zeit – und das hört man auch. Dieses Vollmundige … also, ich habe eigentlich die Stimme dafür, ich könnte das machen, aber es kommt einfach nicht aus mir raus. Was kommt, ist immer dieses Kopfstimmige. Das ist so eher meins. Und dazu diese Riffs. Mein Mann hat zu diesem Song dann auch diese Stimmeffekte gebaut, das bin ja auch ich, so eine beschnittene Stimme, wie ein Sirenengesang, der auch so ein bisschen gruselig ist. Das passt schon zu der klassischen Geschichte von der bösen Hexe im Lebkuchenhaus. Und am Ende nimmt sie dir die Seele und das Herz, und du bist ihr Gefangener.
So ist das mit den Hexen im Lebkuchenhaus: Du landest als Herz im Einmachglas auf dem Regalbrett und als Seele an der Kette im Hinterhof.
(beide lachen)
Ihr bezeichnet das Ganze ja als „Dreampop“. Bei dem Begriff habe ich immer ganz fürchterliche Assoziationen an Weichspülklänge, die in Cover mit dem Sonnenuntergang entgegenspringenden Delphinen verpackt sind … Aber sowas höre bei euch, bis auf dieses Flächenhafte, ja überhaupt nicht, gottseidank.
Es ist ja immer das Problem: Was ist das denn, was wir da machen? Keine Ahnung! Aber ich fand es ganz passend, weil: The Cure gilt ja auch als Dreampop.
Naja, wenn überhaupt, dann Dreampop noir, wobei ich da ganz klassisch mit Gothic oder Wave glücklicher wäre …
Ich glaube einfach, dieses Flächige, diese vielen Schichten, die da so ineinanderwabern … das passt da rein. Bei „Sugar“ tatsächlich nicht so sehr, aber „Fire“ und „Moon Behind A Cloud“, die passen da gut hinein. Aber wenn du einen besseren Genrevorschlag hast, ich bin da ganz offen!
Ich empfinde etwa „Secrets“ als totalen Torch Song. Nicht im klassischen Sinne, sondern im buggewesseltoftschen. Aber es ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen des Musikjournalismus, passende Genreeinordnungen vorzunehmen bzw. neue Genres zu schaffen.
Ja, und heutzutage ist das wirklich interessant! Ich hab ja jetzt kein Label hinzugezogen, weil: Wenn man nicht spielen kann und auch keine CDs oder was auch immer verkauft, zahlt man ja erstmal nur drauf – außerdem wollte ich wirklich auch mal die volle Kontrolle haben. Einmal alles alleine machen – und vielleicht auch auf die Schnauze fallen, aber ich wollte mal wissen … man lernt auch sehr viel. Was da alles so dahintersteckt. Dass man sich zum Beispiel Genres ausdenken muss.
Und wie fühlt sich die bis jetzt an, diese volle Kontrolle?
Naja, es ist halt alles total komisch retortig, weil man nicht auftreten kann. Wir sind jetzt gerade in einer rein digitalen Welt unterwegs. Das geht ja nicht nur den Musikern so. Die Leute sind im Homeoffice, dahinten turnen die Kinder rum und vorne will man irgendwie … wie soll ich das nennen? charismatisch rüberkommen. Mir macht das wahnsinnigen Spaß, weil ich eh gerne gestalte und auch ein Typ für Social Media bin. Es ist nicht so, dass ich mich dazu zwingen muss, mir macht das Spaß. Ich habe so eine kleine exhibitionistische Ader, sonst wäre ich auch nicht Sänger geworden, das ist schon okay. Für meinen Mann aber zum Beispiel ist das Horror, der kriegt da gleich Panik.
Ich glaube, man muss dafür auch ein bisschen gemacht sein. Und ich finde es auch ganz schön, weil man so einen Reality Check kriegt, das ist sehr interessant. Aber es ist natürlich auch superschwierig! Ich bin keine kleine, süße Maus, die irgendwie da bei Instagram voll viele Follower hat, weil sie halt so supersexy und so hyperjung und niedlich ist – das kann ich nicht bieten. Das heißt, ich bin eine erwachsene Frau, die sich erlaubt, noch Popmusik rauszubringen, die dann noch nicht mal wirklich in ein Genre reinpasst! Also, man kann es sich bestimmt leichter machen im Leben.
Aber ich merke tatsächlich, dass mich das trotzdem sehr glücklich macht, weil es *wirklich meins* ist. Das ist total ehrlich: Das bin ich und so kling ich und so ist meine Musik und die hab ich selbst geschrieben und ich hab die Covers zwar nicht gemacht, aber ausgesucht, ich habe die Leute ausgesucht, die das spielen, und das ist so richtig mein Baby. Mal ganz hundert Prozent. Sich zu trauen, das rauszubringen, einfach so: Hier, guck mal, mein Herz, bitteschön – das fühlt sich toll an! Selbst, wenn nur drei Leute sagen, ach, ich finde das schön. Es ist ja jetzt nicht so, dass hier die Tausenden von Followern kommen und sagen, darauf haben wir schon immer gewartet! Aber jeder Mensch, den das glücklich macht, der ist für mich … das ist einfach wahnsinnig schön. Man teilt sein Herz mit anderen Leuten.

Glymmar sind Kristiina Tuomi (Vocals), Samuel Halscheidt (Gitarre, Keys, Vocals), Benedikt Jahnel (Piano), Carsten Hein (Bass, Keys) und Immo Philipp Hofmann (Drums).
Mehr Zucker? Hier entlang: www.glymmar.com